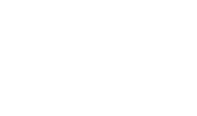Die Dame mit der Brille
Ein Stück in drei Bildern
Musik von Paul Burkhard
Text von Robert Gilbert und Karl Suter
Zusatzstrophen des Couplets "Das ist unfein..." sind von Hans Gmür
Inszenierung
Uraufführung: 31. Dezember 1962
Schauspielhaus, Zürich, Schweiz
- Musikalische Leitung: Rolf Langnese
- Regie: Karl Suter
- Bühnenbild: Pierre Monnerat
Besetzung:
- Kalle: Peter Ehrlich
- Martha: Valerie Steinmann
- Dagobert: Robert Tessen
- Mathilde: Topsy Küppers
- Hans: René Scheibli
- Henny: Inge Bahr
- Florabell: Traute Carlsen
- Willi: Otto Mächtlinger
- Molch: Paul Bühlmann
- Dodermann: Hermann Brand
- August: Fred Tanner
- Frau Mehlhaupt: Angelica Arndts
- Briefträger: Edwin Mächler
- Leichte Mädchen: Bella Neri / Margrit Schoch
- Stammgäste: Ulrich Beck / Luzius Versell
- Mitglieder des Kegelclubs: Bella Beri / Margrit Schoch / Ulrich Beck / Luzius Versell
- Schrebergärtnerinnen und -gärtner: Edith Carola / Marlies Stocker / Peter Ruckstuhl / Josef Sidler
- Akkordeon: Bobby Zaugg
- Baß: Nino Vantozzi
- An zwei Flügeln: Paul Burkhard und Rolf Langnese
Premierenchronik
| CH | UA | 31. Dezember 1962 | Schauspielhaus, Zürich |
Inhaltsangabe
"Eine Kneipe namens 'Schildkröte' an der Berliner Friedrichstrasse habe die Anregung zu der 'Dame mit der Brille' gegeben, wird im Programmheft berichtet. Wir sind also in Berlin an einem Kanal, einem sehr zeitgemäßen Kanal, da er nämlich in Gefahr steht, zugeschüttet zu werden, um Bauland abzugeben. Im gleichen Zuge würde auch die 'Schildkröte' dem Untergang geweiht, um so mehr als der Besitzer, ein ehemaliger Ringer namens Kalle, den Liegenschaftszins nicht mehr aufbringt. Aber seine Frau hat ja eine angeblich steinreiche Schwester Mathilde, sie könnte vielleicht den rettenden Engel spielen, wenn sie sich nur herbeiliesse, sich endlich einmal um ihre Familie zu kümmern. Das tut sie denn auch wirklich: sie ist die bebrillte Dame. Steinreich ist sie nun freilich nicht, hingegen hatte sie ihre Schwester als steinreich ausgegeben - solche Wunschträume sind das einzige gemeinsame Familienmerkmal. Denn so honett und tüchtig Kalles Frau Martha ist, so locker ist Mathilde, die zum Ausgleich mit einem Oberlehrer verheiratet ist, einem Altphilologen, der in freien Stunden seinen Schrebergarten betreut. Mathilde hat einen dunkellockigen Punkt in ihrem Leben, einen schönen Italiener, der sie sitzengelassen hat, nachdem sie ihn ihrer Schwester Martha abspenstig gemacht hatte. Schon damals hing sie Wunschträumen nach, sie hat sich nämlich in einem Brief an die Schwester gerühmt, von besagtem schönen Italiener ein Kind bekommen zu haben.
Den Brief kommt sie nun holen, und die brave Martha gibt ihn ihr. Doch da ist nun Kalle, der Tätowierte, der Muskelprotz, der so gar nicht Oberlehrhafte. Die Geschichte mit dem schönen Italiener wiederholt sich, abermals soll Marthas Mann geschnappt werden. Und Kalle ist gern erbötig. Zunächst aber zieht man einmal hinaus in den Schrebergarten. Man - das heisst, die ganze Belegschaft der 'Schildkröte', eine wilde, ganz und gar nicht kleingärtnerisch gesittete Gesellschaft. Der Oberlehrer ist ausser sich, seine Mitgärtner ebenfalls, doch rettet ihn ein hübscher Rausch, der ihn einen Ringkampf zwischen Kalle und einem Schweizer namens August Homer zitierend miterleben lässt. Bacchantisch geht die Gartenszene aus, Charleston und Altphilologie, Berlin und Schweiz, Gärtnerleidenschaft und unbotanische Seitensprünge verkreuzen sich, zuletzt muss sogar die brave Martha vor übler und nicht ganz unbegründeter Nachrede gerettet werden durch ihre Tochter Henny, die sich mit dem treuherzigen August verloben lässt, obwohl sie den jungen, von der Technik besessenen Hans liebt., So nebenbei verabreden sich auch Kalle und Mathilde, miteinander durchzugehen.
Aber schliesslich ist das ein Werk Paul Burkhards: man geht nicht durch. So leicht die Mathilde ist, so leicht lässt sie sich auch wieder auf den rechten Weg bringen, wofür die denn auch gleich belohnt wird mit der Entdeckung, sie werde in einigen Monaten ein Kind bekommen, das der stolze Vater schon Achilles getauft hat und dem er seinen ganzen altphilologischen Verstand zu vererben entschlossen ist. Mathilde beordert Kalle zu Martha zurück, diese beordert ihn ihrerseits dazu, den lächerlichen Veston auszuziehen, mit dem er auf Abwegen reisen wollte, und sein Ringerleibchen wieder überzustülpen, und der knallige Geselle gehorcht den beiden kleinen Frauenspersonen, wie wenn sie überlegene Schwergewichte wären. Alles ausser dem Liegenschaftszins wäre somit in Ordnung. Doch da hat ein Stammgast der 'Schildkröte', der Kriminalbeamte a. D. Dodemann, einen Geistesblitz: er erkennt in unserem biederen Landsmann August einen gefährlichen Betrüger, auf dessen Festnahme eine Prämie ausgestattet ist. Und Kalle ist endlich Kalle, er macht den Kerl, der ihn im Schrebergarten noch hinter nützlichen Sonnenblumen knockout geschlagen hat, dingfest, indem er ihn in einen Teppich schnürt. Worauf das schöne Leben am Kanal für alle Beteiligten, als da sind zwei Miniaturverbrecher, zwei Freudenmädchen, eine alte Tänzerin, Kalle, Martha, Hans und Henny weitergehen kann. Dazu blüht ja das neue Leben aus den Ruinen, Achilles wächst seinem Erdendasein entgegen und Hans darf endlich das Technikum besuchen."
ebs: Paul Burkhard: Die Dame mit der Brille. In: Die Tat, 4. Januar 1963, Seite 6.
Kritiken
"Ist es eine Komödie? ist es ein Singspiel? Ein Gebilde aus lauter Vorwänden für Chansons, über welchen Begriff im Programm zu lesen steht: 'Leicht eingängiges, musikalisches Gebilde meist heiterer Natur, kombiniert mit eigens hierfür erdachten gereimten und ungereimten Texten..., bei sachgemässer Ausführung entsteht bisweilen Gesang'. Schwer ist die Frage zu entscheiden."
ebs: Paul Burkhard: Die Dame mit der Brille. In: Die Tat, 4. Januar 1963, Seite 6.
"Das zur Jahreswende am Zürcher Schauspielhaus uraufgeführte Stück in drei Bildern von Robert Gilbert und Karl Suter, 'Die Dame mit der Brille', zu dem Paul Burkhard die Musik schrieb, bedarf silvesterlicher Hochstimmung im Zuschauerraum, wenn man es auch nur einigermaßen lustig finden will. Verzichtet man indessen auf die rosa Brille festlicher Euphorie, so erweist sich das im Berliner Milieu der zwanziger Jahre spielende Stück als ein mühsam zusammengestoppeltes Machwerk, dessen dürftige Handlung durch breitgewalzte Situationskomik verdeckt werden soll und das den fehlenden Witz durch Anzüglichkeiten ersetzt, gemäss dem Refrain: 'Das ist unfein, aber es wirkt!' Gilberts kesse Routine, in deren Berliner Jargon der Kabarettist Suter einige Schweizer Akzente setzte, vermag über die Einfallslosigkeit nicht hinwegzutäuschen, mit welcher die Geschichte der Dame mit der Brille erzählt wird."
Th. T.: Die Dame mit der Brille. Uraufführung im Schauspielhaus Zürich. In: Der Bund, 8. Januar 1963, Band 114, Nummer 9, Ausgabe 02.
"Weit schwieriger ist es, die Musik zu charakterisieren, mit der der hochgeniale und vielerfahrene Hauskomponist Paul Burkhard die Dame mit der Brille und ihre mehr oder minder liebenswerten menschlichen Adnexe bedacht hat. Im allgemeinen möchten wir sie zwischen der Gattung Bühnenweihfestspiel und Schlagerpotpourri einordnen; im besonderen können wir Burkhard gerne attestieren, daß er viele sehr hübsche, durch wirkungsvollen Masseneinsatz bei den Refrains prächtig gesteigerte Couplet beigesteuert hat, vor allem im ersten und zweiten Bild; das dritte lebt musikalisch oft von Reminiszenzen. Von einem großen, unbedingt zwingenden melodischen Einfall war allerdings nichts zu verspüren, aber solche Einfälle lassen sich ja nicht nach Belieben kommandieren, nicht einmal auf Silvester."
W.R.: Silvestervorstellungen in Zürich. Schauspielhaus: "Die Dame mit der Brille" (Uraufführung). In: Neue Zürcher Zeitung, 2. Januar 1963.
Medien / Publikationen
Literatur
- Philipp Flury, Peter Kaufmann: "O mein Papa...", Paul Burkhard, Leben und Werk. Zürich: Orell Füssli 1979.
Empfohlene Zitierweise
"Die Dame mit der Brille". In: Musicallexikon. Populäres Musiktheater im deutschsprachigen Raum 1945 bis heute. Herausgegeben von Wolfgang Jansen und Klaus Baberg in Verbindung mit dem Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. www.musicallexikon.eu
Letzte inhaltliche Änderung: 21. August 2025.