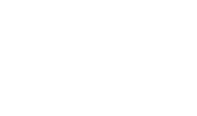Anatevka (Fiddler On The Roof) [Zürich]
Musical
Musik von Jerry Bock
Buch von Joseph Stein
Gesangstexte von Sheldon Harnick
Nach der Erzählung "Tevje, der Milchmann" von Scholem Aleichem
Deutsche Übersetzung von Rolf Merz
Inszenierung
Schweizer Erstaufführung: 15. Juli 1969
Rieter-Park (Freilichtaufführung), Zürich, Schweiz
- Regie und Choreographie: Michael Maurer
- Musikalische Leitung: Dalibor Brazda
- Bühnenbild: Günther Schneider-Siemssen
- Kostüme: Edith Matisek
Besetzung:
- Tevje, ein Milchmann: Shmuel Rodensky
- Golde, seine Frau: Liesel Dieden
- Tevjes und Zeitels Töchter: Reni Walther / Marita Janowski / Irmgard Jedamzik
- Mottel Kamzoll, Schneider: Herbert Dubrow
- Perchik, Student: Michael Rüth
- Lezer Wolf, Fleischer: Chaim Polanis
- Jente, Heiratsvermittlerin: Voli Geilers
- Fedja, ein junger Russe: Bernd Hoffmann
- u.a.
Premierenchronik
| USA | UA | 22. September 1964 | Imperial Theatre, New York |
| Israel | EA | 7. Juni 1965 | Alhambra Theater, Tel Aviv |
| NL | EA | 21. Dezember 1966 | Theater Carré, Amsterdam |
| GB | EA | 16. Februar 1967 | Her Majesty´s Theatre, London |
| D | Dspr. EA | 1. Februar 1968 | Operettenhaus, Hamburg |
| CSSR | EA | 21. Februar 1968 | Tyl Theater, Prag |
| A | EA | 15. Februar 1969 | Theater an der Wien, Wien |
| CH | EA | 15. Juli 1969 | Rieter-Park (Freilichtaufführung), Zürich |
| DDR | EA | 23. Januar 1971 | Komische Oper, Berlin |
Inhaltsangabe
Die Geschichte, die das Musical erzählt, spielt 1905 in dem kleinen Örtchen Anatevka, in der Nähe von Kiew. Tevje ist ambulanter Milchhändler und hat fünf Töchter, von denen drei im heiratsfähigen Alter sind. Doch die Tradition verpflichtet ihn, immer zuerst die Älteste zu verheiraten. Außerdem ist es in Anatevka üblich, dass die Ehe über die Heiratsvermittlerin angebahnt wird. Über ihre Vorschläge entscheiden die jeweiligen Väter, die untereinander auch den Ehevertrag aushandeln. Zu sehen bekommen sich die Brautleute also zumeist erst am Hochzeitstag.
Tevje freilich muss erleben, wie diese Regel, nach der er selbst und seine Frau Golde vermählt wurden, von seinen Töchtern außer Kraft gesetzt wird. Die Älteste, Zeitel, soll nach dem Willen ihrer Eltern den wohlhabenden, aber älteren Witwer Lazar Wolf heiraten. Doch diese hat sich heimlich mit dem armen, aber netten Schneider Mottel Kammzoll verlobt. Kleinlaut bitten sie Tevje um Zustimmung zur Verbindung. Weichherzig, wie er nun einmal ist, gibt er nach.
Die zweite ist Hodel. Sie verliebt sich in den politisch aufgeweckten Studenten Perchik, den auch Tevje mag, der aber über kein nennenswertes Einkommen verfügt. Wie soll man ihm da seine Tochter anvertrauen. Tevje sagt Nein. Doch sie ignorieren sein Verbot und beschließen ohne seine Zustimmung zu heiraten. Tevje wird nur noch um seinen Segen gebeten.
Die dritte Tochter Chava schließlich verliebt sich in den Russen Fedja. Erzürnt verbietet Tevje ihr den Umgang mit ihm: „Er ist eine andere Art von Mensch“, hält er ihr vor Augen. „Wie heißt es im Guten Buch: Bleib unter deinesgleichen. Mit anderen Worten: Ein Vogel liebt möglicherweise einen Fisch. Aber wo wollen sie zusammen ihr Haus bauen?“ Daraufhin tritt Chava heimlich zum russisch-orthodoxen Glauben über und heiratet Fedja trotzdem. Ohnmächtig, trauernd verstößt Tevje sie aus dem Familienverbund. Dies ist seine Grenze. Über die Tradition der Eheanbahnung kann man mit ihm streiten, auch sieht er zähneknirschend darüber hinweg, dass seine Meinung bei der Wahl der Ehepartner nicht unbedingt gefragt ist, doch seinen Glauben aufgeben, dem muss er seine Zustimmung verweigern. „Kann ich alles leugnen, woran ich glaube? Sollte ich versuchen, mich so weit zu verbiegen, ich würde zerbrechen.“ Seine Identität als Jude wäre gefährdet, das Leiden in der Diaspora verlöre ihren Sinn, der stabilisierende Zusammenhalt der Gemeinschaft zerbräche, die fragile Balance des Fiedlers auf dem Dach würde gestört und er stürzte in die Tiefe.
In der Tat lebt die jüdische Bevölkerung von Anatevka unsicher. Sind es zuerst nur Zeitungsberichte und persönliche Erzählungen, die von Judenverfolgungen in anderen Landesteilen berichten, so teilt der Wachtmeister Tevje eines Tages vertraulich mit, dass er die Anweisung zu einem Pogrom auch in dieser Stadt erhalten habe. Ausgerechnet zur Hochzeitsfeier von Zeitel und Mottel schlagen die Russen los und zertrümmern systematisch den ohnehin geringen Besitzstand der Juden.
Schließlich folgt der Erlass, dass sie nicht länger geduldet sind. Sie müssen Anatevka binnen drei Tagen verlassen. Es spielt keine Rolle, dass sie teilweise schon seit Generationen in dem Ort wohnen. Sie haben drei Tage Zeit, um ihr Hab und Gut, das sie nicht mitnehmen können, zu verkaufen. Dann verstreuen sie sich in alle Winde: Jente, die Heiratsvermittlerin, bricht nach Palästina auf, Tevje mit Frau und Töchtern nach Nordamerika, Zeitel und Mottel gehen zunächst nach Warschau (seinerzeit noch zum Russischen Reich gehörend, da es Polen nicht gab), wollen aber später in die USA nachkommen, Hodel ist ihrem Studenten, der nach Sibirien verbannt wurde, gefolgt. Selbst Chava und Fedja verlassen Anatevka. Fedja eher aus Sympathie denn gezwungenermaßen. Sie wollen nach Krakau (was seinerzeit zu Österreich gehörte).
Mit ihnen geht der Fiedler, eine gebrochene Folge der Eingangsmelodie wiederholend. Denn an der unsicheren Existenz der Vertriebenen wird sich auch anderenorts nichts ändern.
(Wolfgang Jansen)
Kritiken
"Zu Beginn sass nämlich, Chagalls Wunderwelt für einen kurzen Augenblick entronnen, der Fiedler auf einem der Dächer von Anatevka ('Fiddler on the Roof') und spielte auf seiner Geige eine Melodie, die, wie auch die nachfolgenden Melodien am Mischpult sorgsam 'behandelt' und über zahlreiche Lautsprecher vervielfältigt, in eben jenes Ohr drang, das ohne Vorbehalte zuzuhören gewillt war. [...] Gemessen an der Weite und Grösse dieser Szenerie einer nächtlichen Stadt konnte der Rieter-Park zwar als unbeträchtlicher kleiner Ort erscheinen. Aber man sass ja auf diesem Punkt fest und durfte deshalb nicht allzusehr in die Höhe und Weite ausschweifen, sondern musste und wollte immer wieder dem folgen, was sich in dem gegeben Mittelpunkt abspielte.
[...] Das ist zur Hauptsache das Team, das es für einen Abend lang Shmuel Rodensky ermöglichte, seine komödiantische Begabung zu versprühen und für glückliche Augenblicke ungetrübte Unterhaltung zu bieten. Aber trotzdem blieb der Abend nur über das eine Ohr und über das eine Auge erträglich. Das ist vielleicht legitim, aber es schmälert dennoch den Genuss beträchtlich, den eine gewiegte Propaganda in reichen Farben vormalte."
C.H.: Harte Plätze - gute Aussicht. "Anatevka" als Sommernachtspiel im Rieter-Park. In: Neue Zürcher Nachrichten, 17. Juli 1969.
"Schließlich drängen sich einige Bemerkungen am Rande auf. Davon, daß man, um viele Plätze zu gewinnen, mit den hintersten zwanzig bis dreißig Stuhlreihen allzu weit vom Bühnengeschehen weggerückt ist, war schon die Rede. Man möchte schließlich nicht nur hören, sondern auch sehen. Daß aber diese problematischen Plätze auch noch zu ausgesprochen hohen Preisen verkauft werden sollen, das könnte den Publikumserfolg des Unternehmens bis zu einem gewissen Grad in Frage stellen. Und wünschbar wäre es, wenn die Stuhlreihen so bezeichnet wären, daß man auch wüßte, auf welche Reihe sich die Bezeichnung bezieht. Die Unklarheit hat am Premierenabend zu Umtrieben und zu mancherlei Aerger geführt. Davon abgesehen aber: dem Musical 'Anatevka' ist zu wünschen, daß der Sommer bis zum 25. August anhält. Die Auszahlung der Regenversicherung wäre für das Publikum, das davon nichts, von den Aufführungen aber viel hat, ein gar schlechter Trost."
wsp.: Anatevka Freilicht-Musical im Rieterpark. In: Neue Zürcher Zeitung, 16. Juni 1969.
Medien / Publikationen
Audio-Aufnahmen
- "Fiddler On The Roof". Original Broadway Cast, Studio-Einspielung vom 27. September 1964, USA 1964, RCA/Ariola International 1985, RD87060 (1xCD).
- "Anatevka". Deutsche Originalaufnahme Operettenhaus, Der Welterfolg des Musicals "Fiddler On The Roof" in deutscher Premierenbesetzung, Studioeinspielung 1968, Hamburg, Teldec 2292-43897-2 (1xCD)
- "Deutsche Originalaufnahme aus ´Anatevka´ (Fiddler on the roof)". Operettenhaus Hamburg, Shmuel Rodensky, CBS 3280, Vinyl-Single 1968, A-Seite: "Wenn ich einmal reich wär´", B-Seite: "Zum Wohl!"
- "Anatevka" ("Fiddler On The Roof"), Melodien-Querschnitt aus dem Musical in deutscher Sprache. metronome 1968, HLP 10.190 (1xLP)
- "Anatevka" ("Fiddler On The Roof"). Original-Einspielung der Inszenierung im Theater an der Wien, Studioeinspielung, Mai 1969, Preiserrecords 93200, Digital remastered 1987 (1xCD).
Video / DVD
- "Anatevka" ("Fiddler On The Roof"). Musicalfilm, USA 1971, Zweitausendundeins Edition, Film 54, B004LR975C. (1xDVD)
Literatur
- Scholem Alejchem: Die Geschichten von Tewje dem Milchhändler. Berlin (DDR): Volk und Welt 1977.
- Peter Back-Vega: Theater an der Wien, 40 Jahre Musical. Wien: Amalthea 2008.
- Wolfgang Jansen: "...überwältigender Witz und wunderbar tiefer Ernst", Zur deutschsprachigen Erstaufführung von Jerry Bocks ´Anatevka´ in Hamburg 1968. In: Der.: Musicals, Geschichte und Interpretation. Gesammelte Schriften zum populären Musiktheater, Band 1, Münster u.a.: Waxmann 2020, Seite 256-263
Kommentar
Die Amsterdamer Premiere war zugleich die europäische Erstaufführung. Die Produzenten änderten den Originaltitel in "Anatevka". Dieser Titel wurde in der Bundesrepublik, Österreich und der Schweiz übernommen.
Sobald ein Programmheft der Schweizer Erstaufführung vorliegt, werden die Angaben ergänzt und gegebenenfalls korrigiert.
Die Erstaufführung in der DDR trug den Titel "Der Fiedler auf dem Dach".
Empfohlene Zitierweise
"Anatevka" ("Fiddler On The Roof") [Zürich]. In: Musicallexikon. Populäres Musiktheater im deutschsprachigen Raum 1945 bis heute. Herausgegeben von Wolfgang Jansen und Klaus Baberg in Verbindung mit dem Zentrum für Populäre Kultur und Musik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. www.musicallexikon.eu
Letzte inhaltliche Änderung: 13. Oktober 2025.